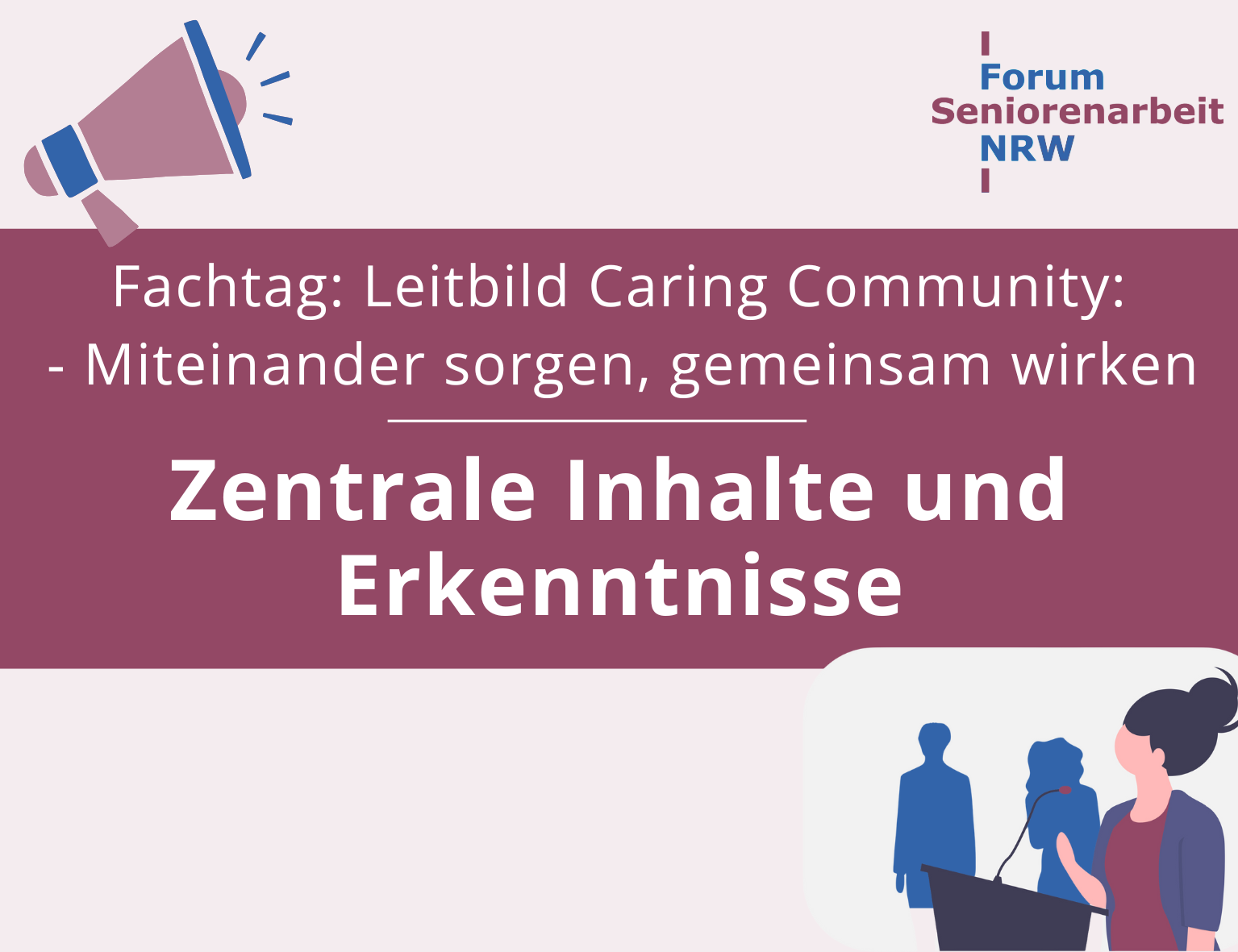Der Beitrag im PDF-Format:
Nachlese_FT_Caring_Community_FSA_NRW
Am 27. August 2025 fand der zweite digitale Fachtag des Forum Seniorenarbeit NRW statt. Zum Thema „Leitbild Caring Community: Miteinander sorgen, gemeinsam wirken – Wege zur lebendigen Sorgekultur“ erwartete die rund 400 Teilnehmenden aus ganz Deutschland ein bunter Blumenstrauß an Kernthemen und Impulsgebenden.

Inhaltlich eröffnete Dr. Tobias Wörle (Hochschule Kempten) den Fachtag mit einem theoretischen Impuls, der die Teilnehmenden in das Leitthema „Sorgende Gemeinschaften“ (engl. Caring Communities) einführte und vermittelte somit eine gemeinsame Wissensgrundlage für die folgenden Tagesimpulse. Sorgende Gemeinschaften gewinnen nach Wörle insbesondere durch die demografisch bedingten Herausforderungen des aktuellen Versorgungssystems an Bedeutung. Es nehmen sowohl traditionelle familiäre als auch professionelle Sorgepotenziale ab, während der Unterstützungsbedarf im Alter zunimmt. Gleichzeitig machen sich vielerorts (etablierte) Formen des Engagements und lokale Initiativen auf den Weg, eine Antwort auf die zunehmend wachsende Sorgelücke zu entwickeln. Definitionen, Konzepte und gestaltende Akteur:innen sorgender Gemeinschaften erweisen sich dabei als vielfältig. Oft treten sie jedoch als lokale Netzwerke im Sozialraum in Erscheinung, in denen Menschen, Nachbarschaften, Vereine, professionelle Dienste und Kommunen Verantwortung mit- und füreinander übernehmen. Sie bündeln beispielsweise professionelle Dienstleistungen (z. B. Pflege) mit ehrenamtlicher Unterstützung und nachbarschaftlicher Hilfe. Im Zentrum steht das Miteinander: Bedürfnisse werden gesehen und erkannt, Potenziale zur Mitgestaltung genutzt und Teilhabe aktiv gefördert. Diese sorgenden Gemeinschaften schaffen daher Räume, in denen Verantwortung geteilt, Ressourcen gebündelt und gegenseitige Unterstützung gelebt wird – und das auf vielfältigen Wegen und konkret für die Menschen vor Ort.
Im Anschluss daran gewährten ausgewählte Praxisexpert:innen spannende Einblicke in ihre Arbeit und zeigten anschaulich, wie sie eine sorgende Gemeinschaft konkret umsetzen und flexibel auf unterschiedliche Bedarfe reagieren.

Dr. David Rester (LUCE-Stiftung) eröffnete die Praxisrunde mit einem Impuls zum Modellprojekt „Agil leben im Alter“ (kurz: ALIA). Die LUCE-Stiftung engagiert sich insbesondere für soziale Entwicklungsprojekte in der Oberpfalz – so auch für ALIA, das in Kooperation mit dem Verein für seelische Gesundheit im Alter e.V. (SEGA e.V.) realisiert wird. Ziel des Projekts ist es, durch partizipative Demokratiearbeit neue, sozialraumorientierte Versorgungsstrukturen zu schaffen, die ein selbstbestimmtes Leben im Alter und den Verbleib im Sozialraum bis ans Lebensende ermöglichen. Dafür setzt das Projekt zunächst auf die Information und Aufklärung von Bürger:innen, um Beteiligung und Eigeninitiative fördern. Mit dem Konzept „Dorf 2.0“ setzt ALIA z.B. auf digitale Informations- und Beteiligungsformate, die Bürger:innen aktiv einbinden und zur Mitgestaltung anregen. Parallel entsteht ein generationenfreundlich geplantes ALIA-Areal, das ab 2027 als inklusiver Lebens-, Wohn- und Begegnungsraum in Betrieb gehen soll. Geplant sind unter anderem barrierefreie Wohnungen, eine Demenz-WG, Tages- und Kurzzeitpflege, Nachtbetreuung sowie Bildungs- und Begegnungsstätten – ergänzt durch Angebote für Kinder wie ein Kindergarten und eine Krippe. ALIA steht damit exemplarisch für ein ganzheitliches Sorgekonzept, das professionelles Handeln mit bürgerschaftlichem Engagement verbindet und den Sozialraum als zentralen Ort des Miteinanders versteht.
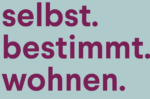
Im weiteren Verlauf stellte Corinna Höckesfeld (Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH) das Projekt „Wohnen statt Unterbringung – reloaded“ (WosU) vor, das zeigt, wie sorgende Gemeinschaften auch im Kontext von Flucht und Migration wirksam werden können. Durch Formate wie das „Dialogforum Wohnen“ in Augsburg oder das bundesweite digitale „Praxisforum Wohnen“ schafft das Projekt Räume für Austausch zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, gegenseitige Unterstützung und gemeinsames Lernen. Im Mittelpunkt stehen Teilhabe auf Augenhöhe, der Abbau von Barrieren und die Vielfalt der Perspektiven. So trägt das Projekt dazu bei, solidarische Netzwerke zu stärken und nachhaltige, diversitätssensible Wohn- und Unterstützungsstrukturen zu entwickeln – ganz im Sinne einer sorgenden Gemeinschaft. Um weitere Akteur:innen zur Nachahmung zu ermutigen, wurde im vergangenen Jahr das Praxisbuch „selbst.bestimmt.wohnen“ veröffentlicht – ein frei zugänglicher Leitfaden zur Gestaltung diversitätssensibler Unterstützungsangebote im Bereich Migration und Wohnen.

Einen weiteren praxisnahen Einblick in die Umsetzung sorgender Gemeinschaften bot Birgit Skimutis (dieKümmerei, HerzNetzCenter GmbH) mit der Vorstellung des Modellprojekts dieKümmerei. Seit 2019 wird das Projekt von der AOK Rheinland/Hamburg gefördert und in Kooperation mit der Stadt Köln sowie dem ärztlichen Sozialunternehmen HerzNetzCenter Köln umgesetzt. Im sozial herausgeforderten Stadtteil Chorweiler verbindet dieKümmerei medizinische und soziale Unterstützung direkt im Wohnumfeld der Menschen – niedrigschwellig, kultursensibel und ohne bürokratische Hürden. Ein multiethnisches Team mit vielfältigen Sprach- und Erfahrungshintergründen begleitet die Menschen individuell, hört zu und schafft Zugänge zu Versorgung, Beratung und Teilhabe. Die Haltung ist dabei zentral: Begegnung auf Augenhöhe, echtes Zuhören und das gemeinsame Suchen nach Lösungen. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteur:innen – von Jobcenter und Familienkasse über therapeutische Angebote bis hin zu Hausärzt:innen – entsteht ein Netzwerk, das nicht nur Einzelfälle unterstützt, sondern auch strukturelle Lücken sichtbar macht. In den Werkstattrunden werden diese Bedarfe gemeinsam mit Vertreter:innen aus Bildung, Gesundheit und Verwaltung aufgegriffen und in modellhafte Lösungen für den Sozialraum überführt. dieKümmerei zeigt beispielhaft, wie sorgende Gemeinschaften durch Präsenz, Vertrauen und sektorübergreifende Kooperation wachsen können – und dass gerade das konsequente „Dranbleiben“ Vertrauen schafft und echte Veränderung ermöglicht.

Nach der Mittagspause zeigte Sonja Heckmann (AWO Kreisverband Bielefeld e.V.), wie sich das Leitbild der sorgenden Gemeinschaft in der Quartiersarbeit konkret umsetzen lässt. Am Beispiel des Bielefelder Modells wurde deutlich, wie barrierefreies Wohnen, soziale Infrastruktur und Orte der Begegnung – etwa Wohncafés – miteinander verbunden werden können. Im Quartier Schildesche arbeiten Bürger:innen, Vereine, soziale Träger und professionelle Dienste eng zusammen, um Versorgungssicherheit und Teilhabe zu stärken. Die Quartiersarbeit setzt dabei auf eine Vielzahl niedrigschwelliger Angebote: von offenen Begegnungsformaten wie Klöncafés oder Lesungen über bürgerschaftliche Initiativen bis hin zu digitalen Lösungen für ältere Menschen. Ergänzt wird dies durch Bildungs- und Beratungsangebote, ein Bürgerforum sowie thematische Arbeitskreise. Projekte wie die „Plauderbank“ zeigen, wie kreativ und bedarfsorientiert das Quartier agieren kann. Es wird deutlich, dass gelingende Sorgearbeit im Quartier neben dem Engagement von Bürger:innen von einer verlässlichen hauptamtlichen Koordination profitiert, die Ermöglichungsstrukturen vor Ort schafft sowie Kontinuität und Stabilität sicherstellt.

Eine lebendige Sorgekultur auf Individualebene stellt Tobias Polsfuß (WOHN:SINN – Bündnis für inklusives Wohnen e.V.) mit einem Impuls zu seiner Arbeit im Verein WOHN:SINN vor. Der Verein setzt sich bundesweit für inklusive Wohnformen ein, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zusammenleben. Polsfuß machte deutlich, dass inklusives Wohnen weit mehr bedeutet als Barrierefreiheit: Es geht um selbstbestimmtes Leben in aktiver Gemeinschaft. Anhand konkreter Beispiele – etwa einer inklusiven Wohngemeinschaft in München oder einem mehrstöckigen Wohnprojekt in Köln mit Nachtassistenz – zeigte er, wie vielfältig und alltagsnah inklusive Wohnkonzepte gestaltet werden können. Grundlage bilden vier Prinzipien: Interaktivität, Adaptivität, Konnektivität und Assistivität. Diese Prinzipien fördern Begegnung, berücksichtigen unterschiedliche Lebensverläufe, verbinden Wohnen mit anderen Lebensbereichen und ermöglichen einen unterstützten, aber selbstbestimmten Alltag für Menschen mit Behinderung. WOHN:SINN begleitet entsprechend inklusive Wohnprojekte mit Bildungs- und Beratungsangeboten, stellt Best-Practice-Beispiele zur Verfügung und bietet Gründungsunterstützung – ein wertvoller Beitrag zur Entwicklung sorgender Gemeinschaften, die alle einschließen.

Den tagesabschließenden Beitrag gestaltete Karin Ohler von der Caring Community Köln. Sie und ihr Team gestalten eine sorgende Gemeinschaft in gemeinsamer Initiative mit dem Palliativ- und Hospiznetznetzwerk Köln e.V. und dem städtischen Gesundheitsamt. Hier steht die Frage im Zentrum, wie eine Stadtgesellschaft mit den Themen Sterben, Tod und Trauer umgehen kann. Die Initiative verfolgt dabei einen umfassenden Ansatz: Neben der Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Bildungs- und Informationsangebote wurden konkrete Unterstützungsstrukturen aufgebaut – etwa ein Beratungstelefon, ehrenamtliche Begleitungen durch sogenannte „Buddies“ oder ein digitaler Wegweiser. Arbeitsgruppen zu Themen wie Trauer am Arbeitsplatz, Kinder und Jugendliche oder Versorgung bündeln das Engagement zahlreicher Akteur:innen. Der Impuls machte deutlich, dass sorgende Gemeinschaften nicht über Nacht entstehen. Vielmehr braucht es einen langen Atem, kommunale Unterstützung, eine klare Koordinierungsstruktur und eine Sprache, die auch Unerfahrene erreicht.
Deutlich wurde aus den Tagesimpulse insbesondere: Sorgende Gemeinschaften entstehen dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, Strukturen gemeinsam gestalten und Vielfalt als Stärke begreifen – sei es im Quartier, im Wohnprojekt oder in der Stadtgesellschaft. Zugleich wurde deutlich, dass der Weg hin zur sorgenden Gemeinschaft vor Ort nicht ohne Hürden ist. Fragen der Finanzierung, das Erreichen von isolierten Menschen sowie die dauerhafte Verankerung hauptamtlicher Strukturen gehören zu den zentralen Herausforderungen. Umso wertvoller erwies sich beim Fachtag der digitale Blick über den eigenen Tellerrand: Der länderübergreifende Austausch mit Expert:innen zeigte, wie bereichernd das Teilen von Wissen sein kann, um erfolgreiche Ansätze weiterzutragen, Netzwerke zu stärken und im Dialog gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
Der Fachtag des Forum Seniorenarbeit NRW wurde tatkräftig und kreativ durch Volker Voigt vom Visualisierungs-fuchs.de begleitet, der die Inhalte der Impulse illustrativ mit einem Graphic Recording festgehalten hat:
Mitwirkende Impulsgebende
 AWO Kreisverband Bielefeld e.V.
AWO Kreisverband Bielefeld e.V.
Sonja Heckmann
Tel.: 0521 329 49 62
Mobil: 0152 594 231 30
E-Mail: s.heckmann@awo-bielefeld.de
Web: www.awo-bielefeld.social/s/quartier-schildesche
 Caring Community Köln
Caring Community Köln
Karin Ohler
Tel.: 0163 67 47 498
E-Mail: info@caringcommunity.koeln
Web: www.caringcommunity.koeln
 dieKümmerei
dieKümmerei
Birgit Skimutis
Tel.: 0221 478 32495
E-Mail: info@diekuemmerei.de
Web: https://diekuemmerei.de/
 Hochschule Kempten, Bayerisches Zentrum Pflege Digital
Hochschule Kempten, Bayerisches Zentrum Pflege Digital
Dr. Tobias Wörle
Tel.: 0831 870235 13
E-Mail: tobias.woerle@hs-kempten.de
Web: www.hs-kempten.de/bzpd-bayerisches-zentrum-pflege-digital
 LUCE-Stiftung
LUCE-Stiftung
Dr. David Rester
Tel.: 09605 919 9386
E-Mail: drester@luce-stiftung.de
Web: www.luce-stiftung.de; www.alia.de
 Tür an Tür-Integrationsprojekte gGmbH
Tür an Tür-Integrationsprojekte gGmbH
Corinna Höckesfeld
Tel.: 0821 907 99 730
E-Mail: corinna.hoeckesfeld@tuerantuer.de
Web: www.wohnprojekt-augsburg.de
 Visualisierungs-Fuchs.de
Visualisierungs-Fuchs.de
Volker Voigt
Tel.: 0221 26139573
E-Mail: hallo@visualisierungs-fuchs.de
Web: https://www.visualisierungs-fuchs.de
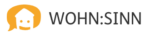 WOHN:SINN – Bündnis für inklusives Wohnen e.V.
WOHN:SINN – Bündnis für inklusives Wohnen e.V.
Tobias Polsfuß
Mobil: 0175 123 700 2
E-Mail: tobias.polsfuss@wohnsinn.org
Web: www.wohnsinn.org
Letzte Aktualisierung: 15. September 2025